Dubois, Paul (1829-1905), Florentinischer Sänger, 1865
Paul Dubois(1829 Nogent-sur-Seine - 1905 Paris), Florentinischer Sänger , 1865. Hellbraun patinierte Bronze mit gegossener runder Plinthe auf quadratischem Marmorsockel montiert (3,5 cm Höhe). Gesamthöhe 53 cm. Maße der Bronze: 49,5 cm (Höhe) x 20 cm (Länge) x 10 cm (Breite), Gewicht 5,6 kg. Auf der Plinthe mit „P.[aul] DUBOIS“ bezeichnet, auf „1865“ datiert, mit dem Gießereistempel „F. BARBEDIENNE FONDEUR“ und dem Signet „REDUCTION MECANIQUE A. COLLAS“ versehen.
- Patina sehr vereinzelt nachgedunkelt, Laute mit Verlust eines Stimmwirbels, ansonsten ausgezeichnet erhalten.
- Die Renaissance der Renaissance -
Bei der Bronze handelt es sich um die präzise ausgeführte und meisterhaft gegossene zeitgenössische Reduktion von Paul Dubois‘ im Musée d’Orsay ausgestelltem, 155 cm hohen Hauptwerk „Florentinischer Sänger“, für welches dem Künstler im Pariser Salon 1865 die Ehrenmedaille verliehen wurde. Das Werk wirkte wie ein Fanal, in dessen Nachfolge eine Fülle an Jünglingsdarstellungen geschaffen wurden.
Der von Donatello und Luca della Robbia, aber auch von Malern wie Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli und Pinturicchio inspirierte „Florentinische Sänger“ ist kein epigonales Werk, das einer untergegangenen Epoche huldigt, sondern der gelungene Versuch, die Lebendigkeit aus der Kunst der Vergangenheit herauszuschöpfen und ihr dadurch ein neues Leben zu verleihen.
Die Lebendigkeitswirkung ist der Kern der italienischen Kunsttheorie der Renaissance. Um sich als Kunst zu erfüllen, hatte die Kunst wie die Natur zu erscheinen. Dieser Naturalismus zeichnet auch den „Florentinischen Sänger“ aus. Der Jüngling wirkt wie aus dem Leben gegriffen, was durch das Augenblickhafte seiner Handlung noch gesteigert wird. Er hat gerade einen nunmehr verklingenden Akkord angeschlagen. Zudem wird die naturgemäße Erscheinung durch die äußerst detaillierte Ausformung gegenständlicher Einzelheiten gesteigert, wie die Schnürenkel mit dem leicht aufgewölbten Leder der Schuhe, der Gürtelschnalle oder der Ornamentik am Korpus der Laute. Selbst die Fingernägel sind klar definiert. Im Gegensatz zur Renaissance beruht die Lebendigkeitswirkung hier jedoch nicht auf der „Entdeckung“ der Natur und des menschlichen Körpers, sondern in erster Linie auf der Wiederentdeckung der Kunst des Quattrocento. Die Lebendigkeit des Kunstwerks ist also zugleich eine Wiederverlebendigung dieser Kunst, so dass von einer Renaissance der Renaissance gesprochen werden kann, ganz so, wie die Präraffaeliten zur selben Zeit in England das Quattrocento in die gegenwärtige Kunst überführen.
Dubois nimmt sich des schwierigsten aller Sujets an, der Darstellung des Gesangs durch die stumme Skulptur. Darin gingen ihm Luca della Robbia und Donatello mit ihren in den 1430er Jahren geschaffenen Sängerkanzeln im Museo dell’Opera del Duomo in Florenz voraus. Im Vergleich zu diesen Werken ist die Physiognomie des Sängers von Dubois‘ weit unbewegter und doch veranschaulicht auch er das Singen auf überzeugende Weise. Dazu hat er sich des gesamten Körpers bedient. Er greift den für die Skulptur der Renaissance wesentlichen antikischen Kontrapost auf und überführt die Standbein-Spielbein-Haltung in einen spätmittelalterlichen S-Schwung, wodurch der Körper eine äußerst elegante Schönheit aufweist und zugleich in eine melodische Bewegung versetzt wird. In der ebenfalls eleganten Fingerhaltung kommt mit dem Schlagen der Laute die Musik auf weit wörtlichere Weise zum Ausdruck. Im Gesicht schließlich mit dem zum Gesang geöffneten Mund kulminiert die Musikalität der Skulptur.
Durch den Akt des Singens – und dies ist eine besonders große Herausforderung für den künstlerischen Willen, vollendete Schönheit darzustellen – wird die Anmut des klassischen Antlitzes nicht beschnitten, sondern noch gesteigert. Ausgehend vom Gesicht mit dem singenden Mund und dem von den Klängen absorbierten Blick verbreitet sich die innere Lebendigkeit, die der Bronzeplastik eine von der Musik verstärkte intensive Aura verleiht. Dubois transferiert die Schönheit der Renaissance ins Musikalische und sublimiert die sichtbare Skulptur ins Unsichtbare der Musik.
Er hat sich der Herausforderung angenommen, mit der Renaissance über die Renaissance hinauszugehen und damit nachträglich den im ausgehenden 17. Jahrhundert im Umfeld der französischen Akademie entfachten, bis ins 19. Jahrhundert virulenten Querelle des Anciens et des Modernes beantwortet, bei dem die Antike entweder als unerreichbares Ideal oder als zu überflügelnder Maßstab gesehen wurde. Mit seinem Werk hat Dubois den Beweis angetreten, dass gerade aus der für die Kunst der Alten einstehenden Renaissance eine Renaissance der Kunst eröffnet werden kann.
zum Künstler
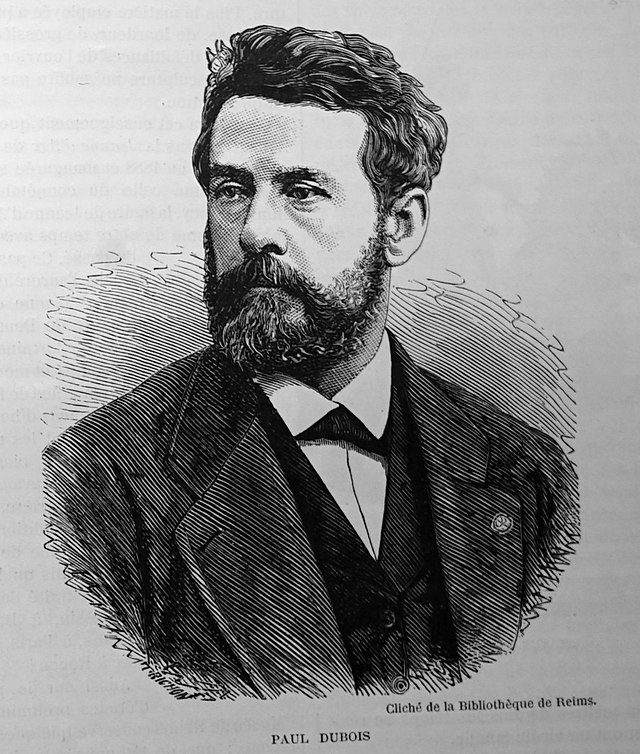
Paul Dubois‘ Großonkel war der berühmte französische Barock-Bildhauer Jean-Baptiste Pigalle, in dessen Fußstapfen der talentierte Großneffe trat. Bei seinem Debüt im Pariser Salon, 1858, signierte er mit „Dubois-Pigalle“. Auf Wunsch des Vaters studierte er jedoch zunächst Jura bevor er sich 1856 unter der Anleitung von François Christophe Armand Toussaint der Bildhauerei widmete und 1858 in die École des Beaux-Arts eintrat. Von 1859-1863 hielt er sich in Rom auf und unternahm Reisen nach Neapel und Florenz. Von der florentinischen Kunst des Quattrocento inspiriert, initiierte Dubois einen schulbildenden neo-florentinischen Stil, der die elegant einfachen Formen jugendlicher Anmut mit präzisem Detailreichtum verknüpft.
Bereits während seines Aufenthalts in Rom erfolgen zwei Ankäufe seitens des französischen Staats („envois de Rome“), die ihm in Paris Anerkennung verschafften. Nach seiner Rückkehr dorthin wurde er schnell zum international gefragten Künstler, dessen Werke vor allem in Bronze, aber auch Gips, Terrakotta und Sèvres-Porzellan Verbreitung fanden.
Dubois war auch als Schöpfer von Denkmälern tätig. Sein bekanntes Werk ist die Reiterstatue der Jeanne d'Arc (1896) auf dem Vorplatz der Kathedrale von Reims. Zudem war er ein gefragter Porträtist, der etwa 50 Büsten und – Dubois war auch leidenschaftlicher Maler – um die 100 Porträts in Öl anfertigte.
Von 1873 bis 1878 war er Konservator des Museum du Luxembourg, 1876 wurde er Mitglied des Institut de France und von 1878 bis 1905 leitete er als Direktor die École des Beaux-Arts.
Für seinen „Florentinischen Sänger“ erhielt Dubois 1865 die Ehrenmedaille des Pariser Salons. 1867 wurde er Chevalier, 1874 Officier, 1886 Commandeur der Légion d'honneur, die Dubois 1896 mit dem Grande Croix auegezeichnete.
Literaturauswahl
Stole, Elmar: Paul Dubois. In: Saur. Allgemeines Künstlerlexikon, Bd. 30, München - Leipzig 2001, S. 677-678.

